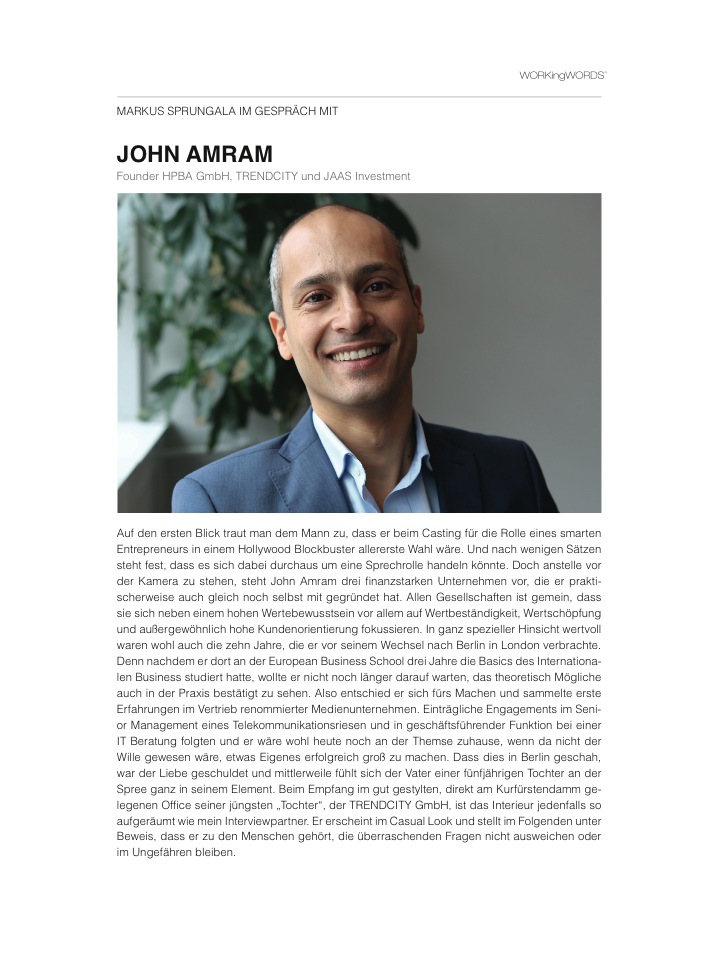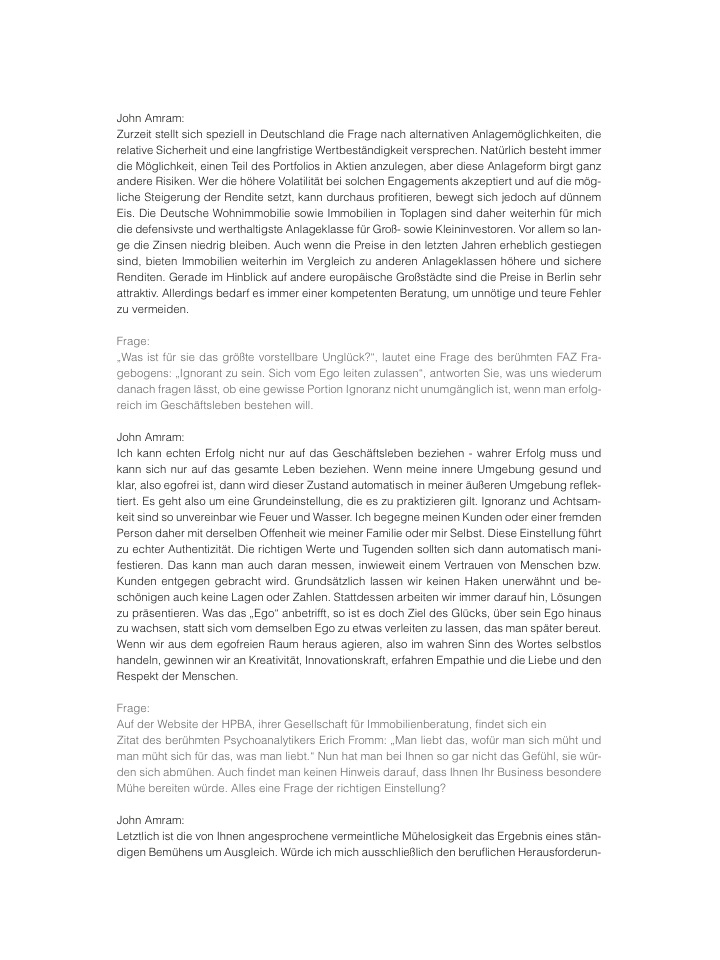Die Premiere der ALLIANZ KUNDLER GRAND CHAMPIONS erweist sich als Glücksfall für den LTTC und den Tennisport in der Hauptstadt.
Wir wollen uns gar nicht erst vorstellen wie es gewesen wäre, wenn sich außer Jim Courier auch Petrus unpässlich gezeigt hätte. Die Weisheit, dass sich das Glück vorzugsweise die Tüchtigen aussucht, nahm sich der himmlische Wettermacher offensichtlich zu Herzen und ließ selbige nicht im Regen stehen. Nach einem überraschend freundlichen Turnierauftakt am 27.Juni ging er am darauf folgenden Sonntag in die Vollen und hatte so großen Anteil daran, dass Tausende von Tennis begeisterten Sehfrauen und Sehmännern auf der weitläufigen Anlage des LTTC Rot-Weiß Berlin 1897 hinter ihren nunmehr ja tatsächlich unentbehrlichen Sonnenbrillen glänzende Augen bekamen.
Dabei hatte es anfangs nicht unbedingt danach ausgesehen, dass der wagemutige Pilot wie geplant über die große Bühne geht. Denn wie so oft, wenn sich wenige entschließen, etwas wirklich Neues auf die Beine zu stellen, gibt es auch immer jene, die versuchen, ihnen hierbei ein Beinchen zu stellen und solche, die sich darin üben, das gerade entstehende Große systematisch klein zu reden. Hinzu kommen jede Menge Eitelkeiten sowie unterschiedliche Ansichten darüber, wie dieses gewaltige Unternehmen profitabel, aber dennoch bezahlbar zu stemmen ist.
Gut, dass sich das Quartett bestehend aus LTTC Präsident Werner Ellerkmann, Sponsor David Patrick Kundler, Veranstalter Frank Lichte sowie LTTC Sportdirektor Markus Zoecke von nichts und niemandem beirren ließ. Zusammen mit den Vorständen des LTTC und ungezählten helfenden Händen gelang es in nur wenigen Wochen, dem seit Jahren unschön dahin siechenden Steffi Graf Stadion Glanz und Anmut zurück zu geben. Eine Kultstätte des europäischen Tennisportes wurde quasi über Nacht zur Geburtsstätte eines Turniers, das es bis dato in dieser Form noch nirgends gegeben hat. Neben den vorgenannten Herren trugen übrigens auch zwei rot-weiße Damen wesentlich dazu bei, dass sich der Club so souverän präsentierte wie lange nicht mehr. Klaudia Zoecke sorgte mit stilsicherer Hand und tatkräftiger Unterstützung der Villa Stein dafür, dass im Grand Slam endlich eine für preußische Verhältnisse schon fast glamourös anmutende Atmosphäre einkehrte. Auch die Betreuung prominenter Zeitgenossen, bei der bekanntermaßen ein gewisses Fingerspitzengefühl gefragt ist, war hier und bei den umsichtig agierenden Servicekräften und Sicherheitsteams in besten Händen. Katrin Kempe managte das bei solchen Erstaufführungen unvermeidliche administrative Chaos mit der stoischen Gelassenheit einer Marathonläuferin und behielt auch dann die Nerven, wenn Dritte wirklich nervten. Weitere Glücksfälle in Form von Mitgliedern, die mit ihrem Ideenreichtum, intelligentem netzwerken und selbstverständlicher Hilfsbereitschaft erhebliche finanzielle Einsparungen realisieren konnten, kamen hinzu. Hier werden sich nach gelungenem Auftakt in Zukunft sicherlich noch weitere Unterstützer finden.
Wie gut das neue Legenden Konzept funktioniert, wurde in dem Moment deutlich, als es aufs Äußerste gefährdet schien. Schließlich trat mit der extrem kurzfristigen Absage der vermeintlichen Zugnummer Jim Courier der GAU schon ein, bevor das Ganze überhaupt losging. Auch hier wollen wir uns lieber nicht vorstellen, was beispielsweise dem Veranstalter Frank Lichte angesichts dieser Absage durch den Kopf ging. Doch spätestens als der Spiritus Rektor des Turniers, Markus Zoecke, sichtlich übernächtigt in der Mitte des Center Court stehend, aus der Not eine Tugend machte, nichts schön redete und stattdessen ein „Jetzt erst recht“ in den Subtext brachte, freute man sich über seine Klasse und auf das Format.
Apropos Klasse. Wie der LTTC Hoffnungsträger „Rudy“ Rudolf Molleker erstmals vor großer Kulisse sein Match gegen den fulminanten Entertainer und wohl populärsten Tennisbotschafter der Grande Nation, Henri Leconte, gestaltete, machte deutlich, warum er den Spielern seiner Altersklasse längst enteilt ist. Beeindruckend unbeeindruckt spielte er Leconte die Bälle zu, ließ ihn seine Spielchen machen und punktete letztlich, ohne wirklich weh zu tun. Respekt. Dem Jungen sieht man an, dass er Federer als Vorbild hat.
Pat Cash, der nach wie vor einen Zug in der Vorhand und einen Schlag bei den Frauen hat, warf seine verschwitzen, heiß begehrten Stirnbänder mit der Grandezza eines Toreros in die Ränge. Wimbledon- und Olympiasieger Michael Stich präsentierte sich hingegen hanseatisch nüchtern und kämpferisch konzentriert. Er ist in diesem Kreis spielerisch die Nummer Eins und verzichtet fast gänzlich auf Show & Emotion. Warum sich mit denen messen, die das ganz offensichtlich besser können? Stich missioniert lieber seine Leidenschaft für technisch einwandfreies Tennis und teilt uneitel seine Expertise mit dem Nachwuchs. Wer dabei war als er am frühen Sonntagmorgen zwei hochkonzentrierten, jungen Topathletinnen auf Platz 1 geschlagene 75 Minuten Serviceunterricht vom Allerfeinsten spendierte, weiß, wie ungemein positiv der Mann tickt.
Leconte ist als Maitre de Plaisier „tout le Monde“ in seinem Element und gewinnt auch die Herzen des Berliner Publikums im Handumdrehen. Er hat sichtlich Spaß am Spiel und sorgt im Zusammenspiel mit dem kongenialen Tennisartist Monsieur Mansour Bahrami immer wieder für staunendes Raunen im Rund, dass früher oder später hoffentlich auch in Las Vegas vernommen wird. Als designierter Ehrenturnierdirektor der ALLIANZ KUNDLER GRAND CHAMPIONS hat es sich Ilie Nastase trotz gerade überstandener Operation nicht nehmen lassen, in Berlin dabei zu sein. Der fast 70jährige, mehrfache Grand Slam Sieger und ehemalige Nummer 1 im Welttennis freut sich sichtlich darüber, dass zu später Stunde auch sein junger Freund Henry zu großer Form aufläuft.
Mahnte unlängst noch Boris Becker, dass dem Tennis in Zukunft echte Typen fehlen könnten, so wäre er angesichts der Avantgarde vom LTTC und der Allianz dieser vier Tennisgrößen im Stadion seiner Wohnzimmerfreundin sicherlich begeistert gewesen.
Beim Abschied fällt der Blick auf eine vom Mondlicht beschienene Formation automobiler Legenden von betörender Linienführung. Unter anderen haben es sich zwei rassige britische Raubkatzen, eine Pagode mit Stern und ein ebenfalls phantastisch aussehendes französisches Cabriolet auf der roten Asche bequem gemacht, was wohl nicht allen gefallen haben soll. Dabei hat es sich schon der Symbolik wegen gelohnt, die rot-weiße Linie einmal im Jahr zu überfahren. Schließlich sind auch sie Champions einer Epoche, in der weniger Verzicht und Vorsicht und mehr Vermögen und Vertrauen das Denken und Handeln der Menschen inspirierte.
Die ALLIANZ KUNDLER GRAND CHAMPIONS werden auch 2016 eindrucksvoll beweisen, dass Akzeptanz, Attraktivität und Aura im Tennisport noch nie eine Frage des Alters war. In diesem Format treffen Expertise und Exzellenz auf Ehrgeiz und Vehemenz. Eigentlich kein Wunder, dass so etwas matcht.